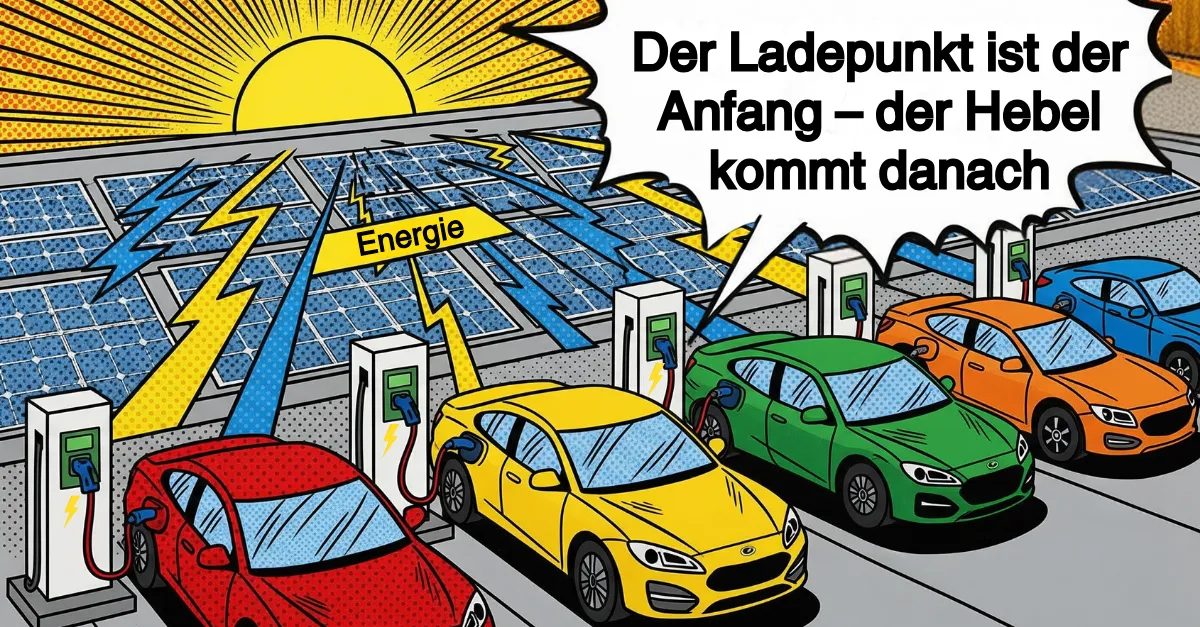
Mehr Strom, mehr Strategie: Ladeinfrastruktur als Pflicht und Chance für Immobilien
Energiebedarf wächst – aber die Strategie fehlt
Die Elektromobilität boomt. Im ersten Halbjahr 2025 stieg die Zahl der in Deutschland zugelassenen vollelektrischen Fahrzeuge wieder um 26 % an. Für viele ein Fortschritt – für die Immobilienwirtschaft eine strategische Zumutung. Denn wo E-Autos sind, muss Strom fließen. Und dieser Stromverbrauch ist alles andere als ein Nebenschauplatz.
Wer ein Immobilienportfolio verwaltet, dem stellen sich nun neue Fragen: Wie berechne ich den zusätzlichen Bedarf? Wie binde ich die Ladeinfrastruktur sinnvoll ein? Und wie verhindere ich, dass mein Energiehaushalt aus dem Gleichgewicht gerät? Der Wandel in der Mobilität ist eine Energiefrage – und die verlangt klare Antworten.
Ladeinfrastruktur: die neue Pflichtausstattung?
Die politische Richtung ist klar: Eigentümer größerer Wohnanlagen und gewerblicher Gebäude müssen perspektivisch Ladepunkte ermöglichen – oder zumindest vorbereiten. Die novellierte Ladesäulenverordnung und das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) machen es deutlich: Wer heute baut oder grundlegend saniert, muss Ladeinfrastruktur mitdenken.
Für Neubauten ist das inzwischen Standard. Doch der wahre Hebel liegt im Bestand. Dort, wo Tiefgaragen auf 30 Jahre alten Plänen basieren. Wo elektrische Grundversorgung auf Haushaltsstromniveau läuft. Und wo der zusätzliche Verbrauch durch E-Autos nicht nur neue Sicherungen verlangt, sondern eine neue Denke: Strom wird zur Mobilitätswährung.
Der neue Energieverbraucher im System: Strombedarf realistisch einschätzen
Ein Ladepunkt mit 11 kW, täglich genutzt, summiert sich schnell auf mehrere Tausend Kilowattstunden pro Jahr – pro Stellplatz. Bei zehn Stellplätzen ist das ein Mehrverbrauch, der im energetischen Gesamtkonzept bisher nicht berücksichtigt wurde. Doch genau dieser Zusatzverbrauch beeinflusst:
die Gesamtbilanz eines Gebäudes im Energieausweis,
die Auslegung von PV-Anlagen und Speichern,
und nicht zuletzt: das Lastprofil im Netzanschluss.
Immobilieneigentümer müssen sich fragen: Ist das System überhaupt dafür ausgelegt? Und wenn nicht – was kostet es, es anzupassen? Die Nachrüstpflicht ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte lautet: Wer nicht vorbereitet ist, zahlt später doppelt – mit Netzanschlusskosten, Zeitverzögerungen und im schlimmsten Fall mit Mieterkonflikten.
Mieterstrom trifft Mobilität: eine verpasste Chance?
Viele Wohnungsbaugesellschaften investieren derzeit in Photovoltaik – zu Recht. Doch noch immer denken viele das Thema E-Mobilität davon getrennt. Dabei liegt genau in der Kombination das wirtschaftliche Potenzial: Solaranlagen können ideal genutzt werden, um Strom für die Mobilität bereitzustellen – vorausgesetzt, Lastprofile werden abgestimmt und Speicher intelligent eingesetzt.
In der Praxis bedeutet das: Die PV-Anlage auf dem Dach produziert tagsüber. Der Mieter kommt abends nach Hause und lädt sein Fahrzeug. Ohne Speicher ist dieser Strombedarf nicht gedeckt – der Strom wird teuer vom Netz bezogen. Mit Speicher jedoch kann der tagsüber produzierte Strom am Abend bereitgestellt werden.
Wer hier klug plant, kann nicht nur CO₂-neutralen Strom anbieten, sondern ein attraktives Mietermodell aufsetzen – und gleichzeitig den eigenen Energieverbrauch optimieren.
Netzdienlichkeit als strategischer Hebel
Eine große Sorge vieler Eigentümer: Was, wenn alle Mieter gleichzeitig laden wollen? Das Netz bricht zusammen. Diese Sorge ist berechtigt – und gleichzeitig lösbar. Das Stichwort lautet „Lastmanagement“. Mit Hilfe intelligenter Ladesysteme lässt sich steuern, wann welches Fahrzeug wie viel Strom erhält. Priorisierungen, Zeitfenster, Netzauslastung – all das kann berücksichtigt werden.
Zudem gibt es erste Modelle, bei denen Ladepunkte netzdienlich betrieben und sogar vergütet werden. Das bedeutet: Wer mitdenkt, wird belohnt. Wer nicht, wird belastet.
Förderlandschaft: Das wird aktuell unterstützt
Auch 2025 gibt es attraktive Förderungen für Ladeinfrastruktur – insbesondere für Immobilienbesitzer, die strategisch in Kombination mit Photovoltaik, Speichern und Mieterstrommodellen denken. Wichtige Programme:
KfW 441: Für Ladeinfrastruktur im gewerblichen Kontext
BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude): In Kombination mit Sanierung oder PV-Nachrüstung
Landesprogramme: Z. B. NRW, Bayern, Berlin bieten zusätzliche Mittel
Entscheidend ist: Förderung gibt es selten für einzelne Ladepunkte ohne System. Erst wenn das Konzept ganzheitlich gedacht wird – also mit Erzeugung, Steuerung, Nutzung – wird daraus ein tragfähiges Modell.
Drei Eigentümer, drei Wege: Praxisbeispiele
1. Wohnbaugenossenschaft, 38 Gebäude, 450 Wohneinheiten
→ Installation von 16 Ladepunkten in vier Tiefgaragen, gekoppelt mit PV und Speicher. Mieterstrommodell eingeführt, monatlicher Mobilitätszuschlag 35 €. Ergebnis: 100 % Auslastung, positive Resonanz, Einsparung von Netzstrombezugskosten um 21 %.
2. Projektentwickler, drei Quartiere in der Planung
→ Quartierskonzepte mit überdachten Lade-Carports, eingespeist durch PV. Mobilitäts-App zur Steuerung, Mieterbindung über Mobilitäts-Flat. Ergebnis: Förderquote 42 %, Flächenverwertung verbessert.
3. Gewerbepark, fünf Gebäude mit Büros, Hallen und Lager
→ Ladepunkte für Firmenfahrzeuge und Mitarbeitende, steuerlich als Betriebsausgabe geltend gemacht. Ergebnis: verbesserte ESG-Bilanz, neue Mieter durch Mobilitätsangebot gewonnen.
Herausforderungen ernst nehmen – aber strategisch lösen
Natürlich gibt es Stolpersteine: Genehmigungen, Netzanschlüsse, Abrechnungsmodelle, Nutzerkommunikation. Doch diese Herausforderungen lassen sich planen – wenn die richtigen Partner mit im Boot sind. Wer Ladeinfrastruktur als einmalige Investition betrachtet, unterschätzt den Wert. Wer sie hingegen als strategisches Werkzeug einsetzt, verbessert die Gesamtperformance seiner Immobilie – ökologisch wie wirtschaftlich.
Fazit: E-Mobilität ist nicht nur Mobilität – sondern Energiepolitik im Kleinen
Eigentümer, die jetzt handeln, schaffen sich einen echten Vorteil. Nicht nur, weil sie gesetzlichen Vorgaben gerecht werden. Sondern weil sie ihr Gebäude zukunftsfähig machen – und damit resilient gegenüber Marktentwicklungen. Denn klar ist: Der Stromverbrauch wird steigen. Die Frage ist nur: Wer steuert ihn? Wer integriert ihn wirtschaftlich sinnvoll? Und wer bleibt auf der Strecke?
Lassen Sie sich nicht treiben – gestalten Sie. Jetzt Strategiecall buchen und konkrete Optionen besprechen.
