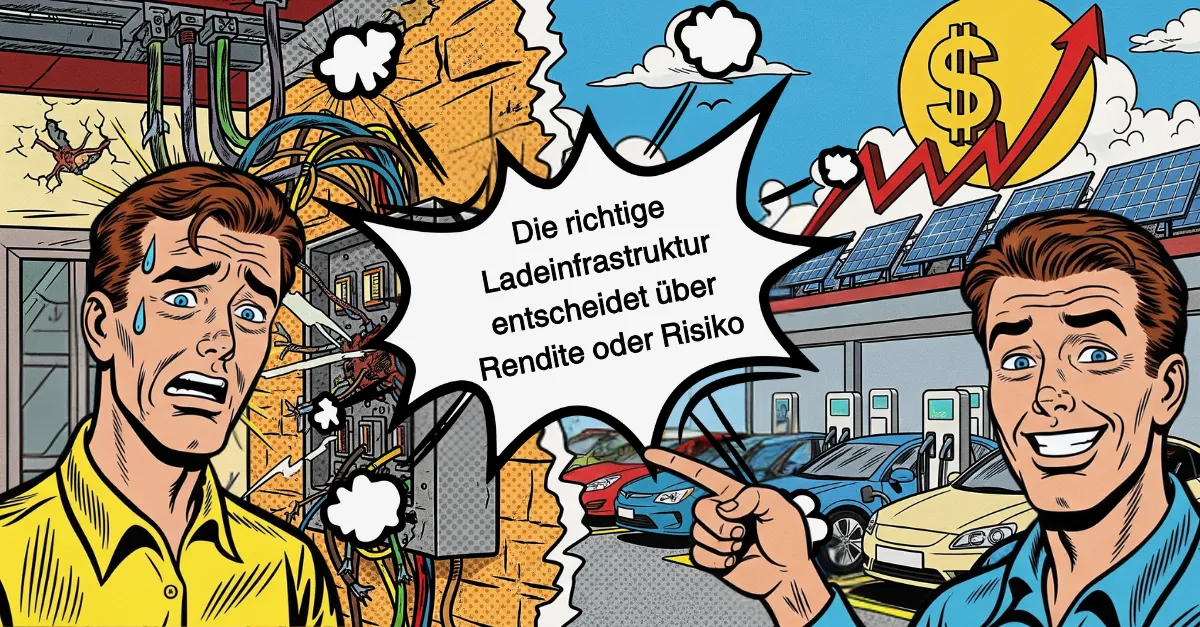
Die perfekte Ladelösung für Ihr Gebäude – worauf Entscheider jetzt achten müssen
Einleitung: Zwischen Pflicht und Potenzial
Ladeinfrastruktur ist kein Nice-to-have mehr. Sie ist Pflicht – in doppeltem Sinn: rechtlich und strategisch. Immer mehr Immobiliengesellschaften spüren den wachsenden Druck. Mieter, Eigentümer, öffentliche Fördergeber und ESG-Standards verlangen Ladepunkte. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Wie viele Ladepunkte? Mit welchem System? Wer zahlt – und was bringt es wirtschaftlich?
Wer glaubt, ein paar Wallboxen reichen aus, greift zu kurz. Ladeinfrastruktur ist längst ein zentraler Hebel für Portfoliostrategie, ESG-Scoring und Mieterbindung geworden. Und: Sie kann zur Einnahmequelle werden – oder zur Dauerbaustelle. Entscheidend ist die richtige Herangehensweise.
Rechtlicher Rahmen: Warum jetzt geplant werden muss
Die gesetzlichen Vorgaben verschärfen sich rasant. Bereits seit 2023 schreibt das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) für neue Wohngebäude mit mehr als fünf Stellplätzen vor, dass jeder Stellplatz vorbereitet sein muss – Leerrohrpflicht inklusive. Für Nichtwohngebäude und gemischt genutzte Objekte gelten ähnliche Anforderungen.
Was bislang als „Vorbereitung“ galt, wird ab 2025 zur realen Pflicht: Ladepunkte müssen installiert, in Betrieb genommen und nachgewiesen werden – vor allem bei Modernisierungen und im Zuge energetischer Sanierungen. Fördermittel für Gebäudestrom gelten oft nur noch in Kombination mit Ladeinfrastruktur. Und das ist nur die regulatorische Seite.
Technische Realität: Eine Wallbox ist keine Lösung
Die meisten Gebäude sind nicht auf die dynamische Lastverteilung und Ladebedarfe vorbereitet, die heute gefordert werden. Die klassische Installation einzelner Wallboxen führt schnell zu Problemen: Lastspitzen, Netzüberlastungen und kostenintensive Nachrüstungen.
Moderne Ladeinfrastruktur denkt ganzheitlich: Sie berücksichtigt Stromflüsse im Gebäude, PV-Anlagen, Speicher und Smart-Meter-Gateways. Wichtig ist ein Lastmanagement-System, das priorisiert, koordiniert und die Energie intelligent verteilt. Nur so können Netzentgelte reduziert, Förderfähigkeit gesichert und eine Erweiterbarkeit garantiert werden.
Wirtschaftlichkeit: Investition oder Kostenfalle?
Die zentrale Frage vieler Eigentümer: Lohnt sich das? Die Antwort hängt von zwei Faktoren ab – der strategischen Nutzung und dem Betreiberkonzept. Wer seine Ladepunkte zukunftsfähig aufsetzt, kann Einnahmen generieren, steuerliche Vorteile nutzen und Fördermittel erschließen.
Beispiel: In einem Mehrfamilienhaus mit 10 Stellplätzen können bei Eigenbetrieb der Ladepunkte monatlich 200–400 Euro Nettoeinnahmen entstehen – abhängig vom Tarifmodell und Nutzungsgrad. Gleichzeitig steigert die Infrastruktur den Immobilienwert, verbessert das ESG-Rating und ermöglicht die Einbindung in Mieterstromkonzepte.
Anders sieht es aus, wenn ohne Strategie einfach nachgerüstet wird. Dann drohen hohe Anschlusskosten, unzureichende Leistung und ungenutzte Ladepunkte – die weder wirtschaftlich noch förderfähig sind.
Betreiberkonzepte im Vergleich: Wer macht was – und mit welchem Risiko?
Viele Eigentümer unterschätzen die Rolle des Betriebs. Wer haftet für Abrechnung, Betriebssicherheit und Wartung? Wer rechnet den Strom ab – und an wen?
Drei Modelle dominieren aktuell den Markt:
Eigentümerbetrieb: volle Kontrolle, volle Verantwortung.
Drittanbieterbetrieb (Contracting): wenig Aufwand, aber Abhängigkeit und oft geringe Einnahmen.
Mischmodell: Eigentümer stellt Infrastruktur, Anbieter betreibt – mit geteilten Erlösen.
Welches Modell sinnvoll ist, hängt von der Immobilie, dem Nutzerprofil und der eigenen ESG-Strategie ab. Entscheidend ist, von Anfang an die richtige Weiche zu stellen.
Fördermittel: Wer nicht beantragt, zahlt doppelt
Viele Programme auf Landes- und Bundesebene fördern Ladeinfrastruktur – insbesondere in Kombination mit PV, Speicher oder Sanierung. Doch die Förderlandschaft ist fragmentiert, die Antragslogik komplex und die Fristen knapp.
Wichtig: Fördermittel werden meist nur bei ganzheitlicher Planung und vor (!) Maßnahmenbeginn gewährt. Wer erst baut und dann fragt, verliert bis zu 40 % der möglichen Zuschüsse.
Planungsfehler vermeiden: Was in der Praxis schiefgeht
In der Begleitung von Immobilienprojekten zeigen sich immer wieder dieselben Fehler: fehlende Lastanalyse, keine digitale Steuerung, unklare Zuständigkeiten, unterschätzte Anschlusskosten.
Das Ergebnis: hohe Nachrüstungskosten, unzufriedene Mieter, Fördergelder, die verfallen – und eine Strategie, die ins Leere läuft. Deshalb gilt: Ladeinfrastruktur ist ein strategisches Projekt, kein Technik-Baustein.
Fazit: Ladeinfrastruktur als strategischen Hebel begreifen
Die gute Nachricht: Wer jetzt strukturiert plant, sichert sich Wettbewerbsvorteile. Die perfekte Ladelösung ist keine Standardware – sie ist das Ergebnis fundierter Analyse, kluger Förderstrategie und wirtschaftlicher Betrachtung.
Wer Ladeinfrastruktur richtig angeht, schafft Mehrwert auf drei Ebenen: für das Gebäude, für die ESG-Bilanz – und für den Ertrag. Jetzt ist der Zeitpunkt, strategisch zu handeln – nicht später.
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, wie Ihre Gebäude von intelligenter Ladeinfrastruktur profitieren können. Termin im Kalender für Strategiecall buchen.
