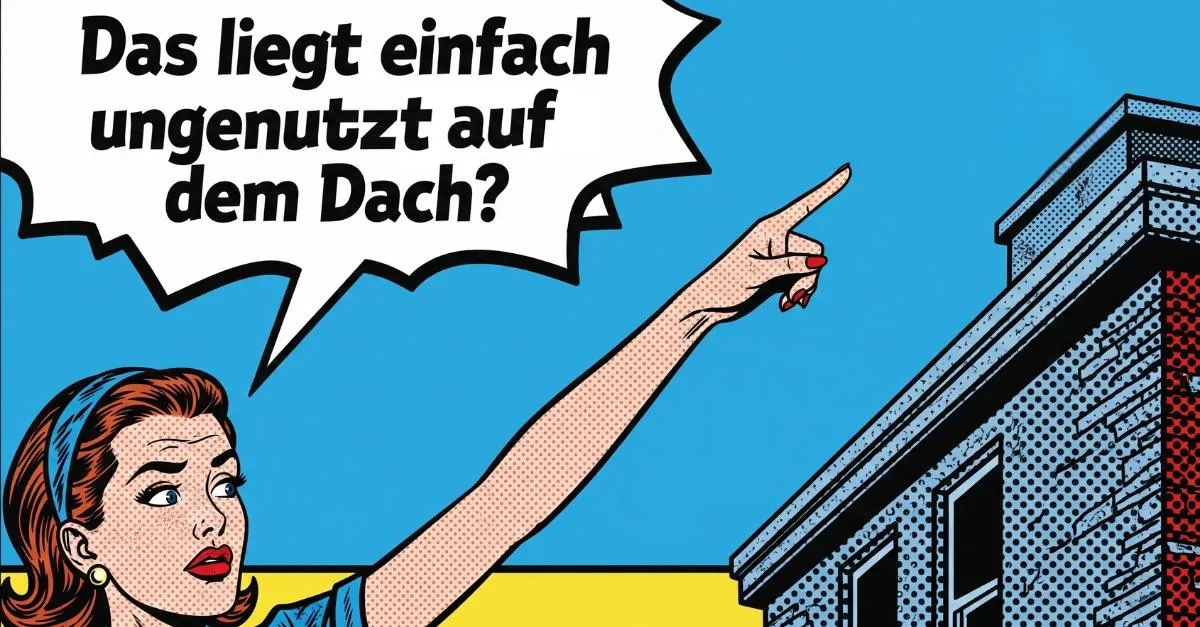
Mieterstrom als Business-Modell: So geht’s
Mieterstrom war lange ein theoretisches Modell für energiepolitische Idealisten. Doch 2025 zeigt sich: Es ist ein konkreter Business Case für Eigentümer.
Mieterstrom verbindet drei Faktoren, die in der Immobilienwirtschaft an Relevanz gewinnen: dezentrale Energieerzeugung, ESG-konforme Bewirtschaftung und wirtschaftlich tragfähige Zusatzrenditen. Für viele Immobilienbesitzer war das Thema lange ein Buch mit sieben Siegeln – zu technisch, zu regulatorisch, zu unsicher. Doch genau diese Unsicherheiten verschwinden aktuell in rasantem Tempo.
Dieser Artikel zeigt, warum sich Mieterstrom heute wirtschaftlich rechnet, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen – und wie Eigentümer von Mehrfamilienhäusern das Modell als strategisches Instrument nutzen können.
1. Was ist Mieterstrom – und was nicht?
Mieterstrom bedeutet: Strom wird dort erzeugt, wo er auch verbraucht wird – auf dem Dach eines Mehrparteienhauses. Die Mieter beziehen den Solarstrom direkt vom Gebäudeeigentümer oder einem zwischengeschalteten Betreiber – und nicht vom Netzbetreiber. Das reduziert Netzentgelte, macht unabhängiger von Strompreissteigerungen und verbessert die CO₂-Bilanz des Gebäudes.
Was Mieterstrom nicht ist: ein Modell für Einfamilienhäuser, eine klassische Einspeisung oder eine rein ideologisch motivierte Lösung. Es ist ein operativ komplexes, aber lohnendes Modell für gewerbliche oder institutionelle Eigentümer mit großem Bestand.
2. Warum Mieterstrom gerade jetzt strategisch relevant ist
2025 hat sich das regulatorische Spielfeld zugunsten von Mieterstrom verschoben. Konkret bedeutet das:
Verbesserte EEG-Förderung: Der Zuschlag für Mieterstrom wurde erhöht und an aktuelle Marktpreise angepasst.
Administrative Entlastung: Dienstleister und Plattformen übernehmen Abrechnung, Lieferverträge und Netzkommunikation.
ESG-relevante Anrechenbarkeit: Mieterstrom verbessert die CO₂-Bilanz eines Gebäudes messbar – und damit auch ESG-Ratings.
Mieterbindung und Imagegewinn: Mieter profitieren direkt – das erhöht Zufriedenheit, reduziert Fluktuation.
Zusammengefasst: Was früher bürokratisch klang, ist heute steuerbar – technisch, finanziell und strategisch.
3. Für wen sich Mieterstrom lohnt
Entscheidend ist nicht nur die Größe des Gebäudes, sondern die Kombination aus Dachfläche, Verbrauchsstruktur und Eigentümerstrategie. Mieterstrom rechnet sich besonders, wenn:
mindestens 6–10 Wohneinheiten vorhanden sind
das Dach nach Süden oder Osten/Westen zeigt
der Stromverbrauch der Mieter relativ konstant ist
Eigentümer bereit sind, mit einem professionellen Dienstleister zusammenzuarbeiten
Am stärksten profitieren aktuell:
Genossenschaften ohne eigene ESG-Abteilung
Projektentwickler mit Quartiersansatz
Immobilienbesitzer mit mehreren Bestandsgebäuden
4. Business Case: Mieterstrom in Zahlen
Ein realistisches Beispiel aus dem Jahr 2025:
Objekt: Mehrfamilienhaus mit 12 Einheiten, 800 m² Dachfläche
Investitionskosten PV-Anlage: ca. 85.000 €
Stromproduktion: ca. 90.000 kWh/Jahr
Eigenverbrauchsquote (Mieter): ca. 65 %
Einnahmen durch Mieterstrom: ca. 16.500 €/Jahr
Betriebskosten: ca. 3.000 €/Jahr
Amortisation: 6–8 Jahre
Nebeneffekte: Bessere ESG-Bewertung, Imagegewinn, höhere Mieterbindung
Fazit: Wer solide plant, erzielt zweistellige Renditen – bei gleichzeitiger Verbesserung der Nachhaltigkeitsperformance.
5. Technische und organisatorische Voraussetzungen
Viele Eigentümer schrecken noch vor der technischen Komplexität zurück. Doch Mieterstrom ist kein DIY-Projekt. Erfolgreiche Modelle basieren auf Kooperationen mit spezialisierten Mieterstromanbietern. Diese übernehmen:
Projektierung und Bau der Anlage
Stromlieferung und Kundenmanagement
Abrechnung und Netzkommunikation
Wartung, Service und Reporting
Der Eigentümer bleibt entweder Betreiber oder überlässt das Modell einem Contractor – ganz abhängig vom Risikoappetit.
6. Mieterstrom und ESG: Warum es bilanziell wirkt
Was viele übersehen: Mieterstrom verbessert nicht nur die CO₂-Bilanz des Gebäudes, sondern wirkt direkt auf ESG-Scores – insbesondere in den Bereichen:
E = Environmental: Reduzierung von Scope-1- und Scope-2-Emissionen
S = Social: Beteiligung der Mieter an der Energiewende
G = Governance: Transparente Kommunikation und klare Datenlage
In der Praxis bedeutet das: Bessere Finanzierungskonditionen, steigende Attraktivität für Investoren, klare Argumente bei ESG-Audits.
7. Fallstricke vermeiden: Was Sie nicht tun sollten
Trotz der Vorteile gibt es Stolpersteine:
Unklare Abgrenzung zum Netzbetrieb
Fehlende Datenstruktur für Verbrauch und Erzeugung
Unprofessionelle Vertragsgestaltung
Zu hohe Renditeerwartungen ohne realistische Einschätzung
Deshalb gilt: Mieterstrom funktioniert, wenn Sie ihn als strategisches Projekt aufsetzen – nicht als Nebenbei-Maßnahme.
8. Fazit: Jetzt starten, bevor andere es tun
Mieterstrom ist kein Experiment mehr – es ist eine wirtschaftlich tragfähige Lösung mit ESG-Relevanz. Eigentümer, die heute aktiv werden, sichern sich nicht nur zusätzliche Einnahmen, sondern auch Vorteile im Wettbewerb um Fördermittel, Finanzierungen und zufriedene Mieter.
Entscheidend ist dabei nicht, wie groß Ihr Bestand ist – sondern wie strukturiert Sie das Thema angehen.
Sie müssen nicht alles selbst machen. Aber Sie müssen jetzt anfangen.
📅 Buchen Sie Ihren Strategiecall und wir zeigen Ihnen, wie Ihr Mieterstrommodell wirtschaftlich funktioniert – Schritt für Schritt.
